Der schöne Traum, Gratis-Internet ohne Werbung
Warum es Werbung bei Notebookcheck gibt und welche Alternativen die Medienbranche derzeit überlegt.
Die Testberichte sind doch schnell geschrieben

Der Name Notebookcheck wird von seinen Lesern üblicherweise mit Testberichten zum Thema Laptops assoziiert. Tatsächlich handelt es sich dabei um prestigeträchtige beliebte Inhalte, die aber zugleich besonders aufwändig in der Erzeugung sind. Viele glauben, die Hersteller und Shops würden uns die Testleihstellungen in rauhen Mengen nachwerfen, was ja auch vernünftig wäre. Schließlich profitieren sie in großem Ausmaß von den Tests. Dennoch ist das Organisieren von Test-Leihstellungen mühsam.
Hat man dann endlich das Gerät, müssen umfangreiche Messungen aller Art gemacht werden, Text (um die 4000 Wörter pro Testbericht) und Fotos erzeugt werden und in das Content Management System eingepflegt werden, Korrekturlesungen sind erforderlich und zuletzt kommen Übersetzungen. Für einen zweisprachigen Testbericht ist insgesamt eine Größenordnung von ca. 30 Arbeitsstunden nötig. Manche Testberichte erscheinen in bis zu 11 Sprachen, in denen Notebookcheck online erreichbar ist. Da die Autoren nicht nach Zeit bezahlt werden, gibt es keinen Grund zu trödeln, der Aufwand erfordert einfach dieses zeitliche Engagement. Pro Monat werden derzeit so um die 40 Tests und andere Artikel veröffentlicht, daneben gibt es aber noch diverse andere redaktionelle Inhalte. Die Website selbst muß gewartet werden, ein Webmaster eines täglich aktualisierten Online-Magazins hat ständig was zu tun. Die Einnahmen müssen organisiert werden. Auch wenn wir uns externer Vermarkter bedienen, müssen wir uns immer wieder über Werbeplätze, Kampagnen, Tausenderkontaktpreise, Klickraten usw. den Kopf zerbrechen. Unvermeidbarer bürokratischer overhead macht auch vor Notebookcheck nicht halt, Buchhaltung muss sein und absurden Rechtsvorschriften aller Art Genüge getan werden. Je mehr Leute mitarbeiten, desto umfangreicher wird unvermeidlicherweise die Verwaltung. Letztlich muss der gesamte Redaktionsbetrieb in vielerlei Hinsicht koordiniert werden. Keiner weiss genau, wieviele Leute exakt zu einem bestimmten Zeitpunkt an der Website mitarbeiten, über 40 sind es aber ständig. Kurzum, zigtausende Arbeitsstunden pro Jahr fallen bei Notebookcheck an.
Geld macht nicht glücklich
Vielen Bloggern und anderen Website-Betreibern macht das posten soviel Spaß, dass sie es ohne kommerzielle Hintergedanken machen. Auch Notebookcheck wurde von seinen drei Gründern einst in der Freizeit betrieben, im ersten Jahr gab es kaum Geld. Auch im zweiten Jahr konnte noch keiner davon ausschließlich leben. In Amerika gibt es den “Ramen profitability level”, mit dem gemessen wird, ab wann ein IT-Unternehmensgründer in der Lage ist, sich selbst billigst zu ernähren, genauer gesagt japanische Instant-Nudelgerichte aus dem Diskonter finanzieren zu können. Die meisten Blogs, Foren und anderen Websites erreichen diese Schwelle nie. Die Betreiber kleinerer IT-Sites sind geeks, oftmals Studenten, die ihre Freizeit dazu verwenden, im Internet interessante Informationen einer Öffentlichkeit anzubieten. Spätestens wenn diese Leute Familien gründen, fehlt an allen Ecken und Enden die Zeit. Ohne finanzieller Perspektive verschwinden die meisten Sites wieder. Die Anzahl der Leute, die freiwillig dauerhaft gratis arbeiten wollen, ist begreiflicherweise enden wollend. Kurzum, alle unsere Redakteure und Übersetzer wollen bezahlt werden. Wieviel Entgelt ist für eine Stunde Arbeit angemessen, 10, 20, 30 € oder mehr? Jeder möge eine eigene Antwort ermitteln und das dann mit zigtausenden Arbeitsstunden multiplizieren. Das ist dann der jährliche finanzielle Dienstleistungs-Aufwand Notebookchecks und bewegt sich in sechsstelligen Dimensionen. Sind wir besonders verschwenderisch? Nein, die Online-Ableger von Verlagsmagazinen vergleichbarer Größe verbrennen meist siebenstellige Jahresaufwendungen, weil die Verlage aus der goldenen Print-Ära ganz andere Unternehmens-Strukturen gewohnt sind als Notebookcheck, das über keine einzige Büroimmobilie verfügt.
Was tun mit den Geld-Bergen?

Manche werden jetzt denken, wenn Medienunternehmen mehr Geld verdienen, dann geben sie das für Blödsinn aus wie schwindelerrengede Managergehälter. Was interessiert mich der neue Luxus-Firmenwagen der Notebookcheck-Geschäftsführung? Also mein Auto ist ein 12 Jahre alter Twingo zu dem mein Bruder anmerkte, dass sein Rasenmäher mehr PS hätte. Üblicherweise fahre ich lieber mit meinem 20 Jahre alten Fahrrad, das mitleidige Diebe 2x wieder stehen gelassen haben...
In den letzten Jahren haben wir den Großteil unserer wachsenden Einnahmen für neuen content verwendet, wir veröffentlichen bespielsweise viel mehr Testberichte als früher, die viel aufwändiger gestaltet sind als in der Frühzeit. Im Gegenzug müssten wir die Menge redaktioneller neuer Inhalte reduzieren, wenn unsere Einnahmen dauerhaft sinken würden.
Objektive Berichterstattung und Geld – Feuer und Wasser

Die für Leser kostenpflichtige Stiftung Warentest verzichtet komplett auf Werbung mit dem Hinweis, dass man nur so komplette Unabhängigkeit gewährleisten kann. Diesen radikalen Ansatz vertreten wir nicht, wir finanzieren uns derzeit ausschließlich durch Werbung, aber wir tolerieren nur Werbung, die für einen Leser, der halbwegs bei Verstand ist, eindeutig als Werbung erkennbar ist. Immmer wieder werfen uns einzelne Leser vor, gute Bewertungen unserer Testberichte wären von Herstellern gekauft worden. Groteskerweise betreffen diese Vorwürfe oft einen großen, allseits bekannten US-Hersteller, der noch nie bei uns in irgendeiner Weise nennenswert geworben hätte. Mit Nachdruck möchte ich klarstellen, wir akzeptieren keinerlei Zuwendungen von Herstellern oder Shops für den Inhalt unserer redaktionellen Beiträge. Mit großer Besorgnis beobachten wir, dass die Grenzen erkennbarer Werbung bei vielen anderen Medien aus der Not heraus verwaschen werden. Noch mehr beunruhigt mich, dass eine große Menge an Internetbenutzern objektive von anderen Informationsseiten nicht unterscheiden kann. Wie objektiv ist ein corporate blog, also zB ein Notebook-Testbericht, der von einem Notebook-Händler veröffentlicht wurde? Wie glaubwürdig sind die Erfahrungsberichte begeisterter Kunden? Wir reden hier teilweise über Konsumenten, die alle 1-2 Jahre ein neues Notebook kaufen, keine Messungen durchführen können und längst nicht eine Vielzahl vergleichbarer aktueller Geräte in den Fingern hatte. Teilweise reden wir aber auch über anonyme Schreiber, die bestürzend oft in Wirklichkeit selbst Verkäufer ähnlicher oder gleicher Ware sind oder von Verkäufern motiviert wurden “Erfahrungsberichte” zu schreiben. Besonders “gerne” höre ich, dass andere Medien neuerdings ihre Leser auffordern für die Aussicht von Zuwendungen Erfahrungsberichte zu schreiben, die dann, nachdem sie von einem Werbekunden selektiert wurden, veröffentlicht werden. Das werden ja dann besonders kritische Berichte sein. Bei uns gibt es Werbebanner, zugegenermaßen sind sie oft lästig, aber das ist unsere klar abgegrenzte, erkennbare Finanzierung. Eine Einmischung der Werbekunden in den Inhalt unserer redaktionellen Artikel wurde und wird ausnahmslos nicht toleriert.
Wo liegt jetzt das Problem

Notebookcheck hat kein aktuelles Finanzierungs-Problem. Im Gegenteil, in den letzten Jahren sind unsere Umsätze stets gewachsen und zwar im mehrstelligen Prozentbereich pro Jahr. Nichtsdestotrotz beobachten wir die Medienlandschaft und da brauen sich in der gesamten westlichen Welt dunkle Wolken zusammen, die von der breiten Öffentlichkeit noch kaum wahrgenommen werden.
Den 80er und 90er Jahren weinen die Verlage wehmütig nach. Ein Werbekunde bezahlte eine Anzeige in einer Zeitung oder einen Fernsehspot, damit diese Werbung von Konsumenten gesehen wird. Nur auf Umwegen konnte geschätzt werden, inwiefern sich Werbung rentiert. Das ist bei Print und Fernsehen noch heute so, doch Printmedien verlieren von Jahr zu Jahr konsequent an Boden zugunsten des Internets. Viele Marketing-Verantwortliche sehnen sich nach der simplen Welt der Zeitungsanzeige zurück. Da prüft man eine Auflage und die Größe der Anzeige und ermittelt anhand dieser Parameter den Preis. Außerdem ist die Anzahl der Print-Publikationen überschaubar. Man kannte die meisten Ansprechpartner gut. Doch das Internet ist ein gigantischer Moloch mit unzähligen technischen Optionen für Werbeoptimierung.
Da hat sich mit der Zeit eine Unsitte eingeschlichen. Bei Internetwerbung bewertet der Werbekunde die Rentabilität der Werbung nur noch danach, wie oft sie angeklickt wird oder wie oft der Leser über die Werbung auf eine Produktseite geht und dort tatsächlich unmittelbar nach dem Anklicken der Werbung das Produkt einkauft. Bei Print oder Fernsehen ist das schlicht nicht möglich. Diese neuen Optionen der Prüfung der Relevanz einer Werbung sind ja grundsätzlich auch positiv, die Unsitte besteht darin, bei Online-Werbung die Sichtbarkeit für den Leser und die daraus resultierende Werbewirksamkeit komplett zu ignorieren. Da Werbung selten angeklickt wird, hat sich daraus ein steter Preisverfall entwickelt. Verlage kolportieren Zahlen, wonach für Online-Werbung der gleichen Reichweite um den Faktor 7 (!) weniger bezahlt wird als bei einer gedruckten Zeitung/Zeitschrift. Früher haben die Menschen ausschließlich Papier in der Hand gehalten und gelesen, heute werden Neuigkeiten in ähnlichem Ausmaß am Computer gelesen. Doch die Werbeausgaben gehen nicht aliquot mit. Die Werbekunden wälzen ihre Werbe-Etats nicht 1:1 von Print zu Online um, sie reduzieren den Preis, den sie für eine Werbeschaltung zahlen. Doch das ist noch nicht das einzige Problem.
Lästige Werbung unsichtbar gemacht – eine konsumentenfreundliche Erfindung

Vor Jahren wollten mir Werbefachleute eines Online-Vermarkters anhand von irgendwelchen Studien einreden, dass Websurfer die Werbung im allgemeinen und natürlich besonders dieses Vermarkters als nützliche Bereicherung sähen. In Wahrheit war Werbung aber immer schon ein vom Konsumenten ungeliebtes Kind. Die Menschen wollen Werbung nicht sehen und schon gar nicht drauf klicken. Nur eine von 100 oder 1000 Werbeeinblendungen im Internet wird angeklickt. Mehr und mehr wird Werbung aber auch einfach durch Software unsichtbar gemacht. In einem Interview hat ein Anbieter solcher Software gemeint, man würde ja nur aufdringliche Werbung blocken. Das ist mir bisher nicht aufgefallen, wenn auf einer Website Werbung eliminiert wird, dann so gründlich, wie es der Software möglich ist. In dem Interview meinte der Anbieter, sie böten eine Liste an, in die sich Site-Betreiber, die bestimmte strenge Richtlinien für kundenfreundliche Werbung einhalten, per Aufnahmeeintrag aufnehmen lassen könnten, sodass ihre Werbung dann verschont würde. Wie praktisch für den Ad-Blocker-Anbieter, dass größere Firmen bezahlen müssen um auf diese Liste zu kommen. Ein Schelm ist, wer da Böses denkt... Unpraktisch für die Site-Betreiber ist , dass es dutzende solcher Adblocker-Software gibt. Auf meinem neuen Laptop war ein Virenscanner vorinstalliert, einen zweiten nahm ich noch dazu. Beide blockierten ungefragt Werbung. Ich wusste davon nicht mal etwas, vermutlich stand es in kleingedruckten Geschäftsbedingungen, die kein Mensch in Wahrheit liest. Als ich diese Funktion ausschalten wollte, wurde ich vom Virenscanner wiederholt eindringlich aufgefordert, das doch zu unterlassen, weil die Sicherheit meines Rechners durch die Werbung gefährdet wäre. Geben wir uns keinen Illusionen hin, wenn das Blockieren von Werbung voreingestellt ist, deaktivieren das die wenigsten Menschen, angeblich 1% laut dem oben genannten Interview. In Frankreich ging ein Internetprovider noch einen Schritt weiter. Sämtlichen Kunden, die über den Provider Zugang zum Internet erhielten, wurde vollautomatisch vom Provider jegliche Internetwerbung blockiert. Da gab es einen Aufschrei französischer Medien und letztlich wurde der Provider von der französischen Regierung “überredet” diese Maßnahme wieder rückgängig zu machen, obwohl der Provider legal gehandelt hatte. Das verdeutlicht anschaulich die Tragweite effektiver Adblocker-Systeme. Besonders auf IT-Sites, wo technik-affine Leser unterwegs sind, soll die Quote blockierter Werbung bereits 25 bis in manchen Fällen über 50% ausmachen. Wer mittels eines Werbeblockers auf werbefinanzierten Seiten surft, ist ein Trittbrettfahrer, der eine Leistung in Anspruch nimmt, aber keinerlei Gegenleistung erbringt. In Bezug auf die Wirkung ist die Benutzung eines Werbeblockers mit Schwarzfahren in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Zechprellerei in einem Wirtshaus zu vergleichen. Der Unterschied besteht nur darin, dass der Internetsurfer rechtlich nicht verpflichtet wird bzw. werden kann Werbung zu klicken.
Im Paradies gibt es keine Reklame
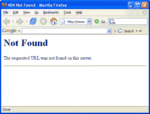
Tatsächlich berichtet die Bibel nicht darüber, dass die Schlange mithilfe einer Werbetafel Adam und Eva zum Apfel-Essen überredet hätte. Wenn man das jetzige Internet gewagterweise als Paradies bezeichnet, was würde dann aus dem Paradies ohne Werbung und ohne einem finanziellen Ersatz für Werbung? Hier unterschätzen meines Erachtens die meisten Internetbenutzer die Auswirkungen. Wenn Werbung im weiteren Sinn (also zB auch Preisvergleich) komplett, dauerhaft und ersatzlos wegfallen würde, würden unzählige Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren und reihenweise würden Websites verschwinden. Dazu gehören alle Verlagsmedien, alle Blogs, die sich Hoffnung machen einmal Geld zu verdienen, Suchmaschinen, Preisvergleicher, Social Media, Youtube, ja sogar Internt-Mailprovider. Was funktioniert dann noch? Websites, die Firmen oder Privatpersonen als digitale Visitenkarten dienen, sowie Online-Shops. Blöderweise werden diese Shops ohne Werbung nicht gefunden und Suchmaschinenen gibt es ja auch nicht mehr, die leben ja auch von Werbung. Simple, selbsterklärende Domains erhalten plötzlich wieder massive Bedeutung, denn nur über Eingabe solcher Domains bzw. Bookmarks wären die Shops und Privatseiten erreichbar. Es gäbe übrigens sehr wohl noch Informationsseiten, einerseits von Regierungsbehörden, andererseits von Unternehmern, die Besucher anlocken wollen wie Steuerberatern, Anwälten, Ärzten usw. Doch es besteht kein Zweifel, ohne Werbung und ohne alternativen Finanzierungsmodellen würde das Internet zur Wüstensteppe. Unabhängier Qualitätsjournalismus, sofern es ihn jetzt noch gibt, er würde auf ein Minimum schrumpfen. Und das ruft sogar träge Regierungen auf den Plan.
Alternative Finanzierung im Internet, da gedeiht Übles
Sperrige Begriffe wie “Paywall”, auch “Bezahlschranke” genannt, und “Leistungsschutzrecht”, von Gegnern auch “Lex Google” genannt, geistern im Netz herum.
Das deutsche Institut für Demoskopie hat letztens das Ergebnis einer Umfrage veröffentlicht, wonach 5% aller Internetbenutzer bereit wäre für Nachrichten im Web zu bezahlen. Nach der “Das Glas ist halbleer”-Methode könnte man auch formulieren, 95% sind nicht bereit dafür zu zahlen. Für diese Erkenntnis braucht man nicht wirklich eine Umfrage, außerdem ist von der mündlich bekundeten unverbindlichen Bereitschaft für Informationen zu zahlen bis zum tatsächlichen und dauerhaften Zücken der Kreditkarte ein weiter Weg. Unvollständige Bezahlschranken können vom kundigen Surfer leicht umgangen werden. Unter einer wirksamen Bezahlschranke leidet mangels Zahlungsbereitschaft der breiten Mehrheit die Reichweite. Und wer für das Medium bezahlt, will nicht zusätzlich mit massenweise Werbung belästigt werden. Stellt sich die Frage, ob die Paywall den Ausfall der Werbeeinnahmen mehr als wett macht. Mehrheitlich wird das eher bezweifelt, allerdings üben sich die Verlage bei diesem Thema gerade in Zweckoptimismus, der nach Durchhalteparolen klingt. Angeblich erfolgreiche Beispiele werden genannt. Im deutschsprachigen Raum ist da von Stiftung Warentest die Rede, die seit einigen Jahren eine recht restriktive Bezahlschranke im Web nutzen. Dieses Medium veröffentlicht dankenswerterweise auch umfangreiche Auflagen- und Wirtschaftsdaten. Was dabei auffällt ist, dass ihre Auflage an gedruckten Heften von 2010 auf 2011 um 3.5% gesunken ist, ihre Online-Bezahlschranken-Einnahmen jedoch um knapp 8% gestiegen sind. Das klingt, als ginge es bergauf, die Sache hat aber einen bezeichnenden Haken. Die Print-Einnahmen sind um den Faktor 15 höher als online. Somit können die Paywall-Mehrverdienste die Verluste im Bereich Print nicht wett machen. Wenn ich versuche abzuschätzen, wieviel Stiftung Warentest mit Werbung derzeit noch verdienen könnte, so habe ich nicht den geringsten Zweifel, dass mit Werbung mehr Geld aus test.de herauszuholen wäre.
Dem Internetsurfer stelle ich eine zentrale Frage in den Raum: wenn man sich zwischen Werbung und kostenpflichtigem Abo entscheiden muss, was ist das geringere Übel? Wer für Werbung optiert, der sollte anfangen sie auch gutzuheissen und zu beachten. Es ist mir rechtlich jedenfalls verboten eine Klickaufforderung auszusprechen.
Ruft die Kavallerie, den Gesetzgeber
So irgendwie scheinen die Verlage weder an den dauerhaften Erfolg von Online-Werbung noch Paywalls zu glauben und haben das sogenannte Leistungsschutzrecht ausgearbeitet. Es gibt recht prägnante und verständliche Erklärungen was das ist. Wenn die Erklärung einfach klingt, ist was faul, denn unter dem Leistungsschutzrecht verstehen verschiedenste Akteure etwas anderes.
Das Grundargument war, dass das Urheberrecht und Medienrecht reformiert werden sollte, also vor allem an das Internet angepasst werden sollte. Speziell im Urheberrecht ist einiges unklar, zB in welchem Umfang wessen Rechte gegen andere Personen geschützt werden. Hier sollen Verleger und Autoren besser geschützt werden. Das ist sogar gleichzeitig möglich. Ich habe auch noch niemanden gefunden, der dagegen gewettert hätte. Doch so wie ein Computervirus huckepack an einem vernünftigen Programm mitgeschickt wird, soll beim Leistungsschutz auch das Zitatrecht genauer formuliert und vor allem eingeschränkt werden. Mit der Metapher Computervirus gebe ich eine Wertung ab, die ich so nicht unbedingt preisgeben will, denn eine Präzisierung, was wann in welchem Umfang zitiert werden darf, kann der Rechtssicherheit auch durchaus dienlich sein. Also haben mächtige deutsche Verlage Lobbyisten zu ihrer Regierung geschickt um ihre Interessen durchzusetzen, wodurch tatsächlich ein Gesetzesvorschlag ins deutsche Parlament kam. Wer davon noch nichts gehört hat, braucht sich nicht schämen, dieser Vorgang lief recht diskret und ungewöhnlich rasch ab. Doch das Interesse der Verlage gilt nicht so sehr der Verbesserung der Rechtssicherheit, sondern es geht schlicht um Geldbeschaffung. Speziell der Internetgigant Google geriet ins Visier. Google hatte über Jahre ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell im Internet entwickelt, die Verlage jedoch nicht. Google verlinkt Redaktionsbeiträge mitsamt einem zitierten Text und bringt so Besucher zu den Verlagen. Dafür monetarisiert Google seine Besucher mittels Werbung. Mitttels gigantischer Besucherreichweite funktioniert das Konzept Werbung für Google auch. Verlage und Google stehen also in einer Art symbiotischer Beziehung, wobei es einer Seite aber immer schlechter geht. Also soll Google an die Verlage bezahlen im Rahmen des Leistungsschutzrechts und so ein Machtgleichgewicht hergestellt werden. Der Schlüssel ist dabei das Zitatrecht. Die Verlage argumentieren, dass Google zuviel Text zitiere und dadurch die Besucher gar nicht erst die Verlags-Artikel besuchen. Offiziell geht es ja nicht nur um Google, wer zuviel Text zitiert und damit Geld verdient, soll eine kostenpflichtige Lizenz erwerben. In der Argumentation geht es dabei um Google News, bei dem Google aber nicht mal Werbung einblendet. Ich habe aber bisher noch nicht entdecken können, wo die rechtliche Abgrenzungslinie zu den herkömmlichen Suchergebnissen von Google sein soll. Angeblich wird bei Google News mehr Text eingeblendet. Das habe ich anhand von ein paar Stichproben überprüft. Ich kam ohne Überschrift auf 135 Zeichen zitiertem Text bei Google News und 125 Zeichen bei Google-Suchergebnissen. Wenn Google seine Zitate in Google News um ein paar Zeichen kürzt, wie sollte man dann rechtlich Google News und Google Suchergebnisse unterschiedlich behandeln?
Krieg der Welten
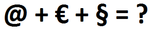
Google wehrt sich, beispielsweise mit dem Argument, dass jeder Websitebetreiber mittels einem Eintrag Google von seinen Seiten abhalten kann. Doch die Verlage wollen sehr wohl die Leistung Googles haben, nämlich verlinkt werden, aber Google soll bezahlen. Google könnte Medienseiten einfach aus seinen Trefferlisten rausschmeissen, aber die Verlage spekulieren auf das EU-Wettbewerbsrecht. Aufgrund der Machtposition Googles könnte die Rechnung – nach jahrelangen Verfahren – aufgehen.
Doch wenn Google im Kartellverfahren verliert, wie verhindert man, dass Google Medienseiten einfach auf schlechteren Positionen und damit auch seltener listet? Um das zu verhindern, müsste Google seine Algorithmen, die sich permanent ändern, Behörden offenlegen. Diese Algorithmen sind Milliarden wert, als Zyniker oder Realist kann man davon ausgehen, dass es undichte Stellen in den Behörden geben wird.
Während die breite Öffentlichkeit lange kaum Notiz von der sperrigen Spezialmaterie nahm, begann ein regelrechter Krieg der Medien zu toben. Die Frontlinien verlaufen vor allem zwischen Online-Medien und Print-Verlagen. Angeheizt wird die Seite der Online-Medien durch das Problem, dass es sich die Politik recht einfach gemacht hat und versucht sich wie ein Aal zwischen den Frontlinien im Schlamm davonzuwälzen. Von Regierungsseite wurde zugegeben, dass der Gesetzesentwurf diverse Unklarheiten enthält, die die Rechtsprechung erst klären muss. Im Klartext heisst das nichts anderes als Abmahnwelle.
Außerhalb Deutschlands tobt der Medienkrieg nicht weniger heftig. Internationales Staunen löste dabei der irische Verlagsverband aus. Der schickte einer karitativen Website kurzerhand eine vierstellige Rechnung, weil Verlagsinhalte ein paar Mal verlinkt wurden. Die Betonung liegt auf verlinkt, es gab gar keinen zitierten Text, wie Google ihn verwendet. Zwar haben die Iren dann zurückgerudert, aber da stellen sich mir schon Fragen. Wissen die Verantwortlichen des irischen Verlagsverbands wie das Internet funktioniert? Wollen sie überhaupt ein Internet oder sehnen sie sich eher nach dem Prä-Internetzeitalter zurück? PR-Aktion? Hat aber dann eher mit einer absehbaren Ohrfeige geendet.
In Frankreich und Belgien gab es zwischen Google und Verlagen Einigungen. In Frankreich investiert Google 60 Millionen in einen Fonds, der digitale Projekte fördern soll. Antragsberechtigt sind, soweit bisher bekannt, nur Print-Verlage. Entschieden wird seitens einer “unabhängigen Kommission”, in der neben Google auch Vertreter der Regierung sitzen (wobei Politiker vom Wohlwollen der Verlage durchaus abhängig sind) sowie wiederum Verlagsvertreter. Nochmals, Anträge stellen die Verlage und entschieden wird über die Anträge auch von Verlagen... Genaue Details des Deals werden geheimgehalten.
In Belgien gab es eine Einigung, deren Details auch nicht genau veröffentlicht wurden. Gerade wenn große Medien dicht halten und kleine Medien nicht bescheid wissen, hunderte Blogger und andere Site-Betreiber werden ja nicht am Verhandlungstisch gesessen sein, dann habe ich irgendwie den Verdacht, dass große Verlagskonzerne besser aussteigen. Das würde auch für Google Sinn machen, befriedige die gefährlichen Gegner, dann kannst du die Schwachen ignorieren.
In Deutschland zeichnet sich noch keine Einigung ab, es wird seitens der Verlage betont, dass die franz. und belgischen Einigungen auf Deutschland nicht anwendbar seien. Gibt es keinen Waffenstillstand, passiert das, was in Brasilien geschehen ist. Google verbannte die Verlage aus seinem Angebot. Für den Internetbenutzer ist das auch alles andere als optimal, eigentlich sogar für niemanden von Vorteil. Wie fast immer im Krieg, zeichnen sich jede Menge Verlierer ab.
Ein dicker Busen nähre ein gefrässiges Kind

Das Kind heisst Verwertungsgesellschaft, genauer VG Wort in Deutschland. Sie erhält Geld und verteilt das dann an Autoren und Verlage. Soweit die Theorie. Diese Verwertungsgesellschaft gibt es bereits und sie hat bereits Geld. Eigentlich könnten auch Notebookcheck-Redakteure und auch die Firma Notebookcheck selbst Geld von der VG Wort bekommen. Wir versuchen das gerade, doch die ersten Anzeichen sind alles andere als ermutigend. Das Kind schlägt um sich mit den Fäusten der Bürokratie. Der Aufwand zu dem Geld zu kommen, scheint kaum in einer vernünftigen Relation zum Nutzen zu stehen. Bezeichnenderweise habe ich selbst von einer Mitarbeiterin der VG Wort die Auskunft erhalten, dass der bürokratische Aufwand zu hoch sei den Anspruch Notebookchecks geltend zu machen. Auch andere Medien und erfahrene Autoren haben erhebliche Probleme an VG Wort Geld zu kommen. Ob der Geldsegen beim Zielpublikum ankommt, muss sich erst herausstellen. Wo das Geld sonst versickert, darüber will ich gar nicht spekulieren.
Der Busen ist entweder Google, wie bereits beschrieben, oder, was bereits jetzt der Fall ist, der Konsument. Ähnlich wie in der Musikbranche bezahlen bereits jetzt Käufer von Speichermedien diverser Geräte einen Beitrag, der den Verwertungsgesellschaften zufließt. Sollte Google, Bezahlschranke und Online-Werbung nicht ausreichen, dann wird diese Keule auf den Steuerzahler viel stärker einschlagen, dessen bin ich mir ziemlich sicher. Noch haben die Verlage Macht und Einfluss und es ist die einzige Möglichkeit effektiv zu verhindern, dass der Internetbenutzer sich wehrt.
Langer Rede kurzer Sinn
Noch haben es die Internetbenutzer in der Hand das geringste Übel auszuwählen. Ich persönlich empfehle Werbe-Banner, in den Alternativen wittere ich das Chaos. Wer Werbung keines Blickes würdigt oder gar mit Werbeblockern eliminiert, ist ein Trittbrettfahrer, der größeres Übel heraufbeschwört.


 Deutsch
Deutsch English
English Español
Español Français
Français Italiano
Italiano Nederlands
Nederlands Polski
Polski Português
Português Русский
Русский Türkçe
Türkçe Svenska
Svenska Chinese
Chinese Magyar
Magyar






