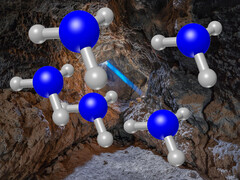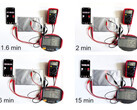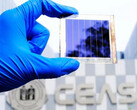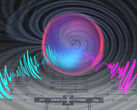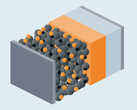Ganz klar, mit reichlich verfügbaren und möglichst ressourcenschonend hergestelltem Wasserstoff ließen sich zahlreiche Probleme lösen. Man kann ihn in Brennstoffzellen in Strom umwandeln. Man kann ihn aber auch direkt verbrennen, um Flugzeugturbinen oder eine entsprechend ausgerüstete Gasheizung zu befeuern.
Und wie sich zeigt, entsteht das Molekül des in der Erdkruste neunthäufigsten Elements auf ganz natürliche Weise. Ist Wasser tief in der Erdkruste hohem Druck und Temperatur ausgesetzt, während die richtigen Mineralien anwesend sind, wird der Sauerstoff gespaltet und H2 bleibt übrig.
Eisen zeigt sich als ein wichtiger Empfänger des Sauerstoffs, weshalb die Bedingungen für die Wasserstoff-Herstellung an vielen Orten der Welt hervorragend sind. Nur ist das winzige Molekül derart flüchtig, dass es sich im Grunde nicht einfangen lässt und schlicht in die Atmosphäre entweicht.
Praktische Umsetzung dank Haber-Bosch
Hier kommt ein Prozess ins Spiel, den Forschende des MIT entwickelt haben. Sie nutzen das Prinzip des Haber-Bosch-Verfahrens zur Ammoniak-Synthese aus, bei dem viel Druck und hohe Temperaturen nötig sind. Außerdem wird meist Wasserstoff aus Erdgas eingesetzt. Kein Wunder also, dass der CO2-Fußabdruck des so wichtigen Verfahrens gigantisch ist.
Völlig anders unterirdisch: Die nötige Energie ist hier schier unendlich vorhanden und alles, was zusätzlich nötig ist, sind Nitrate oder reiner Stickstoff. Dies wird zusammen mit Wasserstoff in die entsprechenden geologischen Formationen gepumpt, sodass nach der Entstehung von H2 die sofortige Umsetzung in Ammoniak erfolgt.
Der Umgang damit ist vertraut, Speicher- und Transportmöglichkeiten über Jahrzehnte erprobt und perfektioniert. Da er durch den Druck unter der Erde flüssig bleibt, ist ein Abpumpen des Ammoniaks möglich.
Und die Vielseitigkeit kann man dem Molekül nicht absprechen. Es ist Hauptbestandteil industrieller Düngemittel. Zudem lässt es sich in Wasserstoff und Stickstoff zerlegen oder sogar direkt als Treibstoff einsetzen.
Noch beruhen die Ergebnisse auf Laborversuche. Allerdings sollen praktische Experimente unter realen Bedingungen schon in den nächsten ein bis zwei Jahren umgesetzt werden, sagt Iwnetin Abate, einer der Autoren der Studie.